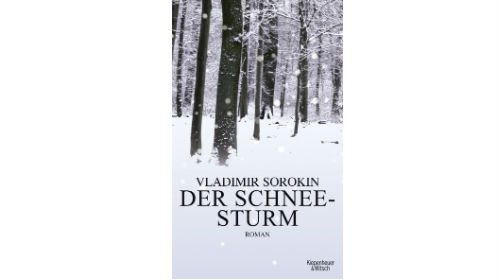
Odyssee im „Schneesturm“
Vladimir Sorokins großartiger Roman über die Zerrissenheit Russlands - Literatur 12/12
Im fernen Dorf Dolgoje ist eine Krankheit ausgebrochen, die man Schwarze Pest nennt und die Menschen in eine Art Zombies verwandelt. Doktor Garin verfügt zwar über ein Serum, das die Menschen retten könnten, nur muss er durch diesen „Schneesturm“, der immer bedrohlichere Ausmaße annimmt. Garin findet nach einigen Komplikationen einen Kutscher mit einem Schneemobil, gemeinsam machen sie sich auf die Reise.
Vladimir Sorokins Roman „Schneesturm“ geht ab wie ein Schlitten mit frisch gewachsten Kufen. Auch wenn er nicht in einer Gemeinschaftsarbeit von Tolstoi, Tschechow und Gogol geschrieben worden ist, klingt er doch so. Die Männer kämpfen sich durch die endlosen Weiten Russlands, sie machen Station auf einem Hof, der Doktor erlebt eine stürmische Liebesnacht, es gibt Defekte am Schlitten. Sorokins Erzählstimme zieht die Leser in das Drama der Männer hinein, bald sitzt man mit ihnen neben den dampfenden Pferden. Und es ist nicht nur die Natur, die sich in den Weg stellt, auch Riesen und Zwerge verhindern die Weiterfahrt. Sorokins Geschichte bewegt sich vom 19. bis ins 22. Jahrhundert. Eine Zeitreise, in der „der Schneesturm die Funktion einer Bühne und einer allmächtigen Gewalt annimmt“, erklärt der Russe.
Immer schon wollte Sorokin - der zu Russlands beliebstesten Autoren zählt - eine solche Wintergeschichte schreiben. Er skizziert den Sturm wie eine Person, wenn er sagt: „Der Schneesturm kommt langsam, er ist keine Lawine. Er verzaubert zunächst, hat keine Eile und erstickt dann das Leben ganz langsam“. Der Roman gibt auch eine Vorstellung davon, dass die Distanz zwischen Provinz und Hauptstadt immer größer wird und heute schon nicht mehr zu überbrücken ist. Eine Erkenntnis, die auch eine politische Dimension besitzt, wenn man etwa an die Verurteilung der drei jungen Frauen der Band Pussy Riot denkt, die von vielen Russen begrüßt wurde. In Sorokins Roman, der so flüssig erzählt ist, öffnet sich immer wieder der Blick auf einen doppelten Boden, der die Ereignisse in das Licht der politischen Ereignisse unserer Gegenwart rückt. „Der Schneesturm ist nicht einfach Schnee mit Wind“, klärt uns Sorokin auf, „sondern er ist die Quintessenz der russischen Metaphysik, die einem unendlichen Raum gleicht, in dem die Menschen verloren gehen und den die Kultur letztlich nicht zu greifen vermag“.
Putins organisierte Jugendbewegung verhöhnt Sorokin auf YouTube, indem sie seine Bücher demonstrativ ins Klo wirft. Der 57-Jährige zeigt sich davon wenig beeindruckt, sein Roman bietet Spannung, Humor und eine atmenden Sinnlichkeit, die das Prädikat Weltliteratur verdient.
Vladimir Sorokin: Der Schneesturm. Deutsch von Andreas Tretner. Verlag Kiepenheuer & Witsch. 208 S., 17,99 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 von Cover_Simenon_Komplizen.jpg) Ein sympathisches Ungeheuer
Ein sympathisches Ungeheuer
„Die Komplizen“ von Georges Simenon - Literatur 12/12
 von 101_Nacht_3D.jpg) Geschichten, die duften und klingen
Geschichten, die duften und klingen
Claudia Ott entdeckt die Handschrift „101 Nacht“ - Literatur 12/12
 von u1_978-3-596-81110-6_003.jpg) Eine Liebesgeschichte wie keine
Eine Liebesgeschichte wie keine
Meg Rosoffs Debüt „So lebe ich jetzt“ - Literatur 12/12
 von 9783283012175.jpg) Madeleines und andere Gegenstände der Verführung
Madeleines und andere Gegenstände der Verführung
Die Ur-Großnichte zeigt „Marcel Proust – in Bildern und Dokumenten“ - Literatur 12/12
 Eine Welt voller Leben
Eine Welt voller Leben
„Der alte Mann und das Meer“ und der Sog des Erzählens - Literatur 12/12
 Das Tagebuch der „ungarischen Anne Frank“
Das Tagebuch der „ungarischen Anne Frank“
Àgnes Zsolt veröffentlichte „Das rote Fahrrad“ Literatur 12/12
 von ch tr en 1212, LitWeih_Tipps, TL, Bulgakow.jpg) Nitzberg zündet Bulgakow
Nitzberg zündet Bulgakow
„Meister und Margarita“ in prachtvoller Neuübersetzung - Literatur 12/12
 Das Papier als größtes Glück
Das Papier als größtes Glück
Bedeutung des Papiers - Literatur 12/12
 von ch tr en 1212, LitWeih_Tipps, TL, Bovary.jpg) Eine Frau, schöner denn je
Eine Frau, schöner denn je
Elisabeth Edl übersetzt „Madame Bovary“ neu - Literatur 12/12
Beziehungen sind unendlich
„Schwarze Herzen“ von Doug Johnstone – Textwelten 01/26
Bewusst blind vor Liebe
„Mama & Sam“ von Sarah Kuttner – Literatur 01/26
Jenseits des Schönheitsdiktats
„Verehrung“ von Alice Urciuolo – Textwelten 12/25
Nicht die Mehrheit entscheidet
„Acht Jahreszeiten“ von Kathrine Nedrejord – Literatur 12/25
Power Kid
"Aggie und der Geist" von Matthew Forsythe – Vorlesung 11/25
Allendes Ausflug ins Kinderbuch
„Perla und der Pirat“ von Isabel Allende – Vorlesung 11/25
Die Liebe und ihre Widersprüche
„Tagebuch einer Trennung“ von Lina Scheynius – Textwelten 11/25
Inmitten des Schweigens
„Aga“ von Agnieszka Lessmann – Literatur 11/25
Mut zum Nein
„Nein ist ein wichtiges Wort“ von Bharti Singh – Vorlesung 10/25
Kindheitserinnerungen
„Geheimnis“ von Monika Helfer und Linus Baumschlager – Vorlesung 10/25
Im Spiegel des Anderen
„Der Junge im Taxi“ von Sylvain Prudhomme – Textwelten 10/25
Die Front zwischen Frauenschenkeln
„Der Sohn und das Schneeflöckchen“ von Vernesa Berbo – Literatur 10/25
Von Ära zu Ära
Biographie einer Metal-Legende: „Sodom – Auf Kohle geboren“ – Literatur 10/25
Kutten, Kohle und Karlsquell
Lesung „Sodom – Auf Kohle geboren“ in Bochum – Literatur 10/25
Alpinismus im Bilderbuch
„Auf in die Berge!“ von Katja Seifert – Vorlesung 09/25
Keine Angst vor Gewittern
„Donnerfee und Blitzfee“ von Han Kang – Vorlesung 09/25


