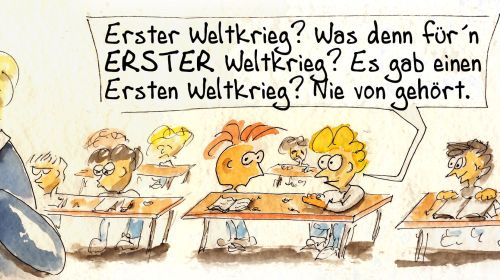
Friedensarbeit
Eine Gelsenkirchener Schule legt einen Unterrichtsschwerpunkt auf den Ersten Weltkrieg – Thema 01/14 Krieg
Woran erinnert man sich noch aus seinem Geschichtsunterricht? An die alten Römer, die Französische Revolution und das Dritte Reich. Dazwischen klaffen dicke Löcher. In eines davon ist der Erste Weltkrieg gefallen. Die Erfahrung machte auch Georg Altenkamp. Und der sitzt an der Quelle als Leiter der Gelsenkirchener Gesamtschule „Berger Feld“. „Der Zweite Weltkrieg wird sehr intensiv in den Schulen bearbeitet und irgendwann werden die Schüler damit auch überfrachtet. Dann kommt es zu einer Übersättigung, die zu Ablehnung führt“, erklärt Altenkamp einen der beiden Gründe für das Projekt seiner Schule: Jedes Jahr machen sich Schüler der Sekundarstufe II auf zur Partnerschule „Heilige Familie“ im belgischen Ypern und nach Istanbul und forschen dort auf den Soldatenfriedhöfen. „Außerdem habe ich kurz vor meinem eigenen Abitur 1966 in Frankreich Kriegsgräber gepflegt“, fährt der Schulleiter fort. „Und dies nun mit dieser Generation zu wiederholen, den Krieg über die Schauplätze und persönliche Schicksale erfahrbar zu machen, anstatt nur über ihn zu reden, zu lesen, oder ihn in Filmen zu sehen, hat eine höhere Qualität.“
Altenkamp geht es nicht um Heldengedenken, sondern um Friedensarbeit. Vor der ersten Fahrt nach Belgien zu den Gedenkveranstaltungen, die der Geschichtslehrer Detlev Kmuche über persönliche Kontakte zu einem Veteranen 1999 initiierte, herrschte noch Skepsis im Kollegium: „Einige Kollegen befürchteten eine paramilitärische Veranstaltung. Stattdessen trafen wir auch Veteranen – in den ersten Jahren gab es noch Zeitzeugen, das war ungeheuer wertvoll für unsere Arbeit.“ Die Schüler und ihre Lehrer waren die ersten Deutschen, die an den Feiern teilnehmen durften. Altenkamp: „Dabei hat die Stadt sehr unter den Deutschen gelitten. In beiden Weltkriegen wurde sie fast ausradiert. Was sich dort an Wiederaufbauwillen gezeigt hat, ist ebenso beachtlich wie die Menschlichkeit, die uns entgegengebracht wird. Diese Erfahrung auch jungen Menschen zu ermöglichen und damit zur Völkerverständigung beizutragen, ist uns ganz wichtig.“ Auch im Unterricht liegt der Fokus nicht allein auf den großen Zusammenhängen, sondern auf der Arbeit mit Originaldokumenten wie Briefen von Soldaten, die als Patrioten freiwillig in den Krieg zogen und denen an der Front mehr und mehr die Augen geöffnet wurden. Altenkamp: „Die Linie aus dem Nationalismus des Deutschen Reiches über die Weimarer Republik in den Nationalsozialismus muss klar werden. Sonst ist der Nationalsozialismus gar nicht zu verstehen.“
Die Arbeit, die die einzelnen Jahrgänge unterscheidet, ist die Kriegsgräberforschung. Jeder der im Schnitt 20 Jugendlichen forscht nach dem Verbleib verschollen gemeldeter Soldaten. In zehn Fällen konnten die Nachfahren und Hinterbliebenen und das Grab ihres Großvaters oder Onkels zusammengeführt werden. Altenkamp: „Es sind stets sehr bewegende Momente wie damals, als der Bürgermeister eines oberfränkischen Dorfs kam, um sich voller Ergriffenheit bei Schülern zu bedanken. Ich denke, nachhaltiger als durch eine solche Anerkennung kann man nicht lernen.“ Nachhaltig soll das Projekt vor allem beim Abbau von Vorurteilen sein. Altenkamp: „Vertrauen aufzubauen ist das Hauptziel über die Grenzen hinweg insbesondere zu Ländern, die sich mal kriegerisch und mit verheerenden Folgen für beide Seiten begegnet sind. Wir wollen den Jugendlichen eine Form des Zusammenlebens in Europa vermitteln, die frei von solchen Ängsten und Vorurteilen ist. Da ergeben sich Freundschaften zwischen den Deutschen, Belgiern und Türken, die es gar nicht mehr zulassen, dass es zu Vorurteilen kommt. Wenn Menschen das erfahren in diesem Alter, dann können sich keine Vorurteile entwickeln.“
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Krieger: Denk mal!
Krieger: Denk mal!
100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bleiben viele Fragen offen – THEMA 01/14 KRIEG
 Kriegseuphorie
Kriegseuphorie
André Wilger über die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges – Thema 01/14 Krieg
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Welt statt Wahl
Teil 1: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 2: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Initative Klimawende Köln
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
Klimaprotest im Wandel
Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Klimaschutz als Bürgerrecht
Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen
Durch uns die Sintflut
Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 1: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 1: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 2: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 3: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Keine Politik ohne Bürger
Wie Belgien den Populismus mit Bürgerräten und Dialogforen kontert – Europa-Vorbild: Belgien


