
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 2: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
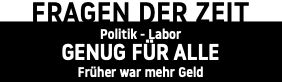
trailer: Herr Ott, Befürworter einer höheren Besteuerung hoher Vermögen betonen, dass Vermögende so einen „fairen Beitrag“ zur Gesellschaft leisten sollten. Gegner einer höheren Besteuerung verweisen auf den „Schutz des rechtmäßigen Eigentums“. Welche Auffassung von Steuergerechtigkeit vertritt Finanzwende?
Lukas Ott: Für mich bedeutet Gerechtigkeit, dass starke Schultern auch mehr zum Steuersystem beitragen sollten. Jetzt gerade ist oft das Gegenteil der Fall: Wenn wir uns unser gegenwärtiges Steuersystem ansehen, stellen wir fest, dass sehr große Vermögen sehr stark geschützt sind, gerade bei der Erbschaftssteuer. Das führt dazu, dass insbesondere diejenigen, die extrem viel Vermögen besitzen, weniger zu unserem Steuersystem beitragen.
„Deutschland auf einer Stufe mit Mexiko oder Indonesien“
Wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht?
In Deutschland wird Einkommen im internationalen Vergleich relativ hoch besteuert – innerhalb Europas etwa gibt es nur ein anderes Land, das Einkommen höher besteuert. Auf der anderen Seite erheben wir auf Vermögen nur sehr niedrige Steuern. Und das, obwohl wir eine sehr konzentrierte Form von Vermögen haben. Deutschland ist im internationalen Vergleich eines der Länder mit der größten Vermögensungleichheit. Vermögensungleichheit wird durch den sogenannten Gini-Koeffizienten gemessen: das ist eine Skala von 0 bis 1, wobei eins bedeutet, dass in einer Gesellschaft eine Person alles besitzt und der Rest nichts, 0 bedeutet, dass alle das Gleiche haben. In Deutschland liegt der Gini-Koeffizient bei den Vermögen bei 0,78. Damit liegen wir ungefähr auf einer Stufe mit Mexiko oder Indonesien. Genau da haben wir ein Problem, und diese Vermögensverteilung wollen wir verändern. Um ein anderes Beispiel zu nennen: In Deutschland besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung knapp 35 Prozent des gesamten deutschen Vermögens, während die ärmeren fünfzig Prozent in Deutschland 2 Prozent des Vermögens besitzen. Wir können also grob sagen, dass einige wenige Familien in etwa so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Dieses Ungleichgewicht sprechen wir an und da diese Verhältnisse sehr viel mit Erbschaften zu tun haben, ist die Erbschaftssteuer eine der zentralen Stellschrauben, an der unserer Ansicht nach eine Reform stattfinden muss. Daher sprechen wir insbesondere die Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer an.
Was macht die Erbschaftssteuer so entscheidend?
Die Vermögensungleichheit in dieser heutigen Form stellt schon eine extreme Form dar. Gleichzeitig ist klar, Vermögensungleichheit gab es schon immer und wird es auch immer geben, das lässt sich nicht vollständig abschaffen. Aber ein entscheidender Faktor ist die Ausnahmeregelung, dass Unternehmensvermögen von der Erbschaftssteuer befreit werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Unternehmensvermögen sogar vollständig von der Erbschaftsteuer befreit werden. Das gilt für andere Vermögen nicht, wie beispielsweise private Vermögen, das Geld auf dem Konto oder Immobilienbesitz. Dadurch kommt es zu der Situation, dass sehr große Vermögen – wir sprechen von Unternehmensvermögen im hohen Millionen- und Milliarden-Bereich – steuerfrei an die nächste Generation weitergegeben werden können, diese andere Form von Vermögen, das Geld auf dem Konto, aber eben nicht. Das heißt, hier findet eine Ungleichbehandlung statt. Ein Grund dafür ist der historische Prozess der Erbschaftssteuer: Schon 2006 hat das Bundesverfassungsgericht das erste Mal die sehr niedrige Bewertung von Unternehmensvermögen bei der Erbschaftsteuer für verfassungswidrig erklärt. Die Erbschaftsteuer wurde daraufhin zwar reformiert, aber neue Ausnahmen wurden ins Gesetz aufgenommen. Über diese Ausnahmen hat das Bundesverfassungsgericht 2014 erneut geurteilt, dass eine vollständige Steuerfreiheit von sehr großen Vermögen verfassungswidrig ist. 2016 wurde daraufhin eine neue Reform von der Bundesregierung umgesetzt, die eine neue Ausnahme schuf, nämlich die Verschonungsbedarfsprüfung. Die macht es aktuell möglich, dass sehr große Vermögen noch immer steuerfrei weitergegeben werden können – also wurde das, was das Gericht kritisiert hat, durch die Hintertür als neue Ausnahme erneut eingeführt.
„Im Steuerkurs: Mythen, als anerkanntes Wissen präsentiert“
Wie äußert sich das konkret?
In der Konsequenz führt es dazu, dass die tatsächlich gezahlten Steuersätze sehr ungleich sind: Zwischen 2021 und 2023 lag der Steuersatz bei Vermögen über 26 Millionen Euro im Schnitt bei 2,9 Prozent, bei deutlich geringeren Erbschaften und Schenkungen betrug er im Schnitt das Dreifache davon. Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz. Sehr anschaulich ist die sogenannte 300-Wohnungen-Regel: Ab einem 301 Wohnungen umfassenden Immobilienbesitz nimmt der Gesetzgeber an, dass man ein Wohnungsunternehmen besitzt. Deswegen gelten diese 301 Wohnungen dann als begünstigtes Unternehmensvermögen und können von der Erbschaft- und Schenkungssteuer ausgenommen werden. Wenn nur eine bis zwei oder drei Wohnungen vererbt werden, müssen dafür Steuern gezahlt werden – vorausgesetzt natürlich, deren Wert liegt über den Freibeträgen. Wenn aber 301 Wohnungen vererbt werden, müssen keine Steuern gezahlt werden. Das ist eine ganz konkrete Gerechtigkeitslücke und diese Lücke sehen wir auch in den Steuersätzen. Bei Groß-Erbschaften über 26 Millionen Euro ist der Steuersatz inzwischen sogar noch geringer – 2024 lag er in der offiziellen Steuerstatistik bei 1,5 Prozent, also nochmal deutlich unter dem Wert von 2021 bis 2023. Dazu gibt es auch historische Analysen, etwa der vergangenen zehn Jahre zu Erbschaften von mehr als 100 Millionen Euro, das waren in diesem Zeitraum 258 Stück: Auf über die Hälfte dieser Erbschaften ist gar keine Erbschaftssteuer angefallen. Es gibt also diese eklatante Lücke, nach der der Steuersatz umso geringer ist, je höher das Vermögen ist. Und für extrem große Erbschaften und Schenkungen fällt häufig gar keine Erbschaft- und Schenkungsteuer an.
Diese Schieflage wird immer wieder angesprochen. Eine politische Reformmehrheit scheint dennoch nicht in Sicht zu sein.
Wir sehen gerade im Steuerdiskurs viele Mythen, die im öffentlichen Diskurs als anerkanntes Wissen präsentiert werden, aber so gar nicht stimmen – das ist durchaus auf wirksame Lobby-Arbeit zurückzuführen. Ein Akteur fällt uns da immer wieder auf, nämlich die Stiftung Familienunternehmen und Politik. Diese Stiftung gibt vor, alle Familienunternehmen in Deutschland zu vertreten, vertritt in der Realität aber vor allem einen kleinen Kreis, nämlich die größten Familienunternehmen. Die sind dafür bekannt, dass sie immer wieder Mythen und Halbwahrheiten in den Diskurs streuen, die wir in unserer Arbeit immer wieder entkräften müssen.
„Wir sind keine Leistungsgesellschaft mehr, sondern eine Erbengesellschaft“
Welche Mythen?
Im Kontext der Erbschaftsteuern hört man etwa, eine gerechte Erbschaftsteuer hätte zur Folge, dass Arbeitsplätze vernichtet oder Reiche ins Ausland fliehen würden. Diese Punkte lassen sich relativ leicht entkräften: Laut einem Bericht des Beirats des Finanzministeriums und einem Bericht der OECD sind es eher die Ausnahmen der Erbschaftssteuer, die dazu führen, dass Unternehmen in Insolvenz und Arbeitsplätze verloren gehen – ganz einfach, weil die Unternehmen in der Familie weitergegeben werden, ohne in Erwägung zu ziehen, ob die Erben überhaupt geeignet sind, ein Unternehmen zu führen. Erben werden unabhängig von einer unternehmerischen Tätigkeit und der persönlichen Eignung privilegiert und das wiederum schafft eine höhere Wahrscheinlichkeit für Insolvenzen und verhindert Innovation. Wir sehen die Gefahr des Arbeitsplatzverlusts also eher in den derzeit bestehenden Ausnahmen und der Privilegierung von Erben, nicht in der gerechten Besteuerung von Unternehmensvermögen.
Das scheint dem Prinzip einer Leistungsgesellschaft zu widersprechen.
Wir sehen inzwischen, dass mehr Vermögen vererbt als selbst erarbeitet wird. Wir sind also schon in der Situation, dass wir keine Leistungsgesellschaft mehr sind, sondern eine Erbengesellschaft. Erbschaft ist in der Frage persönlichen Reichtums ein wichtigerer Faktor als die eigene Leistung. Die Ausnahmeregelungen sind dabei ein zentraler Faktor. Darum legen wir den Fokus darauf und hoffen, dass auch die Unionsparteien sich darauf besinnen, da diese ja sehr stark für eine Leistungsgerechtigkeit argumentieren. Was wir mit der Abschaffung der Ausnahmen letztlich fordern, ist nicht, dass extrem große Vermögen extrem stark besteuert werden, sondern dass sie gerecht besteuert werden, so wie alle anderen Vermögen auch.
„In der Gesellschaft eine klare Mehrheit für eine gerechte Erbschaftssteuer“
Die Argumente leuchten ein. Der Diskurs scheint dennoch von der anderen Seite bestimmt zu sein.
Im Moment gibt es vielleicht noch keine parlamentarische Mehrheit für eine Abschaffung der Ausnahmen, aber es gibt einen politischen Diskurs zu dem Thema, das ist ermutigend. Die SPD greift es immer wieder auf, auch Die Linke und die Grünen – diese drei Parteien sind alle dafür, die Ausnahmen abzuschaffen. Wir sehen sogar innerhalb der CDU Bewegung: Jens Spahn hat das Thema Vermögensungleichheit erst vor einiger Zeit aufgegriffen und eingeräumt, dass die Vermögensungleichheit so eklatant ist, dass sie eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Einzelne Stimmen greifen das Thema also immer wieder auf. Es gibt in der Gesellschaft außerdem eine klare Mehrheit für eine gerechte Erbschaftsteuer: In einer Forsa-Umfrage haben 57 Prozent genau das gefordert. In unserem Bündnis mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit und taxmenow haben wir eine Petition gestartet, in der wir die Abschaffung der Ausnahmen von der Erbschaftssteuer fordern – die wurde nach wenigen Wochen schon von mehr als 200.000 Menschen unterstützt.
So festgefahren, wie es scheint, ist die Situation gar nicht?
Was im Moment wieder sehr viel Momentum schafft, ist, dass die Erbschaftssteuer zurzeit wieder beim Bundesverfassungsgericht liegt. Zwei Urteile des höchsten Gerichts, nach denen die Erbschaftsteuer in ihrer jeweiligen Form verfassungswidrig ist gab es bereits – zwei Mal gab es eine Reform, die an diesem Zustand letztlich nichts geändert hat. Jetzt liegt die Steuer wieder beim Bundesverfassungsgericht. Wir gehen davon aus, dass es die Ausnahmen wieder für verfassungswidrig erklären wird, dann wird die Bundesregierung auch wieder eine Reform umsetzen. Genau in dieser Situation wollen wir in den Diskurs einschreiten, darum haben wir diese gemeinsame Kampagne zum Thema Erbschaftssteuer angestoßen. Wir wollen versuchen ein gesellschaftliches Momentum zu erzeugen und den Reformprozess so zu beeinflussen, dass nicht wieder eine neue Ausnahme geschaffen wird.
„Ausnahmen abschaffen, Einnahmen nahezu verdoppeln“
Welche konkreten Maßnahmen braucht es für ein gerechteres Erbschaftssteuerrecht?
Konkret geht es uns vor allem um die Verschonungsbedarfsprüfung. Diese Prüfung ist eine Ausnahme, die bei der Übertragung von Unternehmensvermögen ab 26 Millionen Euro genutzt werden kann. Da wird geprüft, ob die Person, die die Steuer zahlen müsste, dazu in der Lage wäre – ob sie also genügend privates Geld hat, um die Steuer zahlen zu können. Wenn herauskommt, dass die Person so viel Geld nicht hat, entfällt sie komplett. Das lässt aber einen enormen Gestaltungsspielraum zu. Der Fall des Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner ist ein Beispiel, das relativ stark durch die Medien gegangen ist: Döpfner wollte Anteile an Axel Springer im Wert von 1 Milliarde Euro erhalten und hatte ein privates Vermögen von rund 300 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, dass er, um die Verschonungsbedarfsprüfung nutzen zu können, diese 300 Millionen Euro genutzt hat, um Axel Springer-Aktien zu kaufen. Er hätte sein privates Vermögen also in betriebliches Vermögen verwandelt, das in dieser Prüfung nicht angewendet wird. Die Prüfung hat ihn also arm gerechnet. In den Medien ist man daher größtenteils zu der Bewertung gekommen, dass er durch diesen Trick auf eine Schenkung von einer Milliarde Euro kaum Steuern gezahlt hat, obwohl hunderte Millionen an Steuern fällig geworden wären. Genau diese Lücke wollen wir schließen, das ist einer der großen Hebel, den wir sehen. Die Ausnahmen, von denen wir sprechen, haben laut der aktuellen Steuerstatistik zurzeit einen Umfang von insgesamt 9 Milliarden Euro, davon 3,4 Milliarden Euro alleine durch die Verschonungsbedarfsprüfung. Die Erbschaftssteuer in ihrer jetzigen Form bringt Einnahmen von zehn Milliarden ein – wenn wir die Ausnahmen abschaffen, könnten wir diese Einnahmen also nahezu verdoppeln.
Was halten sie von einem so ambitionierten Ansatz wie einem allgemeinen Grunderbe?
Grundsätzlich halten wir zurzeit jede Debatte für wichtig, die sich mit der Vermögensungleichheit auseinandersetzt. Wir haben für uns diesen sehr starken Fokus auf die Erbschaftssteuer gelegt, weil wir dort das größte politische Potential sehen, auch konkrete Änderungen erreichen zu können, weil wir dort eine konkrete gesellschaftliche Mehrheit für eine gerechter Erbschaftsteuer haben. Gleichzeitig ist jede Debatte über die Vermögensungleichheit eine wichtige Debatte.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Kli Kla Klacks
Kli Kla Klacks
Intro – Genug für alle
 von tr-thema-s1-678.jpg) Gleiches Recht für alle!
Gleiches Recht für alle!
Teil 1: Leitartikel – Aufruhr von oben im Sozialstaat
 von tr-thema-s2-678.jpg) „Eine neue Ungleichheitsachse“
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 1: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
 von tr-thema-s3-678.jpg) Klassenkampf im Quartier
Klassenkampf im Quartier
Teil 1: Lokale Initiativen – Bochums Stadtteilgewerkschaft Solidarisch in Stahlhausen
 von ch-thema-s1-online-678.jpg) Gerechtigkeit wäre machbar
Gerechtigkeit wäre machbar
Teil 2: Leitartikel – Die Kluft zwischen Arm und Reich ließe sich leicht verringern – wenn die Politik wollte
 von ch-thema-s3-678.jpg) Gegen die Vermüllung der Stadt
Gegen die Vermüllung der Stadt
Teil 2: Lokale Initiativen – Umweltschutz-Initiative drängt auf Umsetzung der Einweg-Verpackungssteuer
 von en-thema-s1-online-678.jpg) Die Mär vom Kostenhammer
Die Mär vom Kostenhammer
Teil 3: Leitartikel – Das Rentensystem wackelt, weil sich ganze Gruppen der solidarischen Vorsorge entziehen
 von en-thema-s2-678.jpg) „Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
 von en-thema-s3-678.jpg) Der Kitt einer Gesellschaft
Der Kitt einer Gesellschaft
Teil 3: Lokale Initiativen – Der Landesverband des Paritätischen in Wuppertal
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Der Staat will zuhören
Der Staat will zuhören
Wandel im niederländischen Sozialsystem – Europa-Vorbild: Niederlande
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Armutszeugnis im Reichtum …
Armutszeugnis im Reichtum …
… und alternative Fakten im Wirtschaftssystem – Glosse
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 1: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 2: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 1: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 2: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Kultur muss raus ins Getümmel“
Teil 3: Interview – Philosoph Julian Nida-Rümelin über Cancel Culture und Demokratie


