
Elternreiche Kinder
Herausforderung Stiefvater
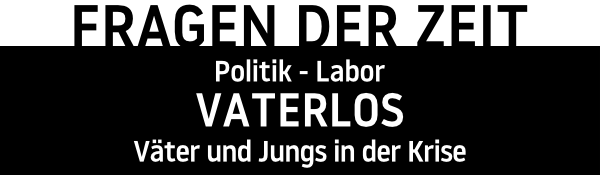
Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune.“ Die Welt sich so malen, wie sie für einen gut ist, das wusste schon Pippi Langstrumpf. In Stief-Familien wird aus eins und eins schnell mal fünf, nämlich dann, wenn die Partner in die neue Beziehung ihre Kinder aus der vorangegangenen Beziehung mitbringen.
„Stief“ bedeutet hierbei nichts Anderes als „verwaist“. Denn in vergangenen Zeiten bekamen die Kinder einen Stiefelternteil, deren Elternteil früh verstarb. Die neue Heirat diente der Familie als sozialer und finanzieller Absicherung. Heute hingegen kommt es häufiger zu Scheidungen und neue Partner treten zusätzlich zu den leiblichen Eltern in das Leben der Kinder. Aus elternlosen Kindern der früheren Jahrhunderte wurden so elternreiche Kinder der Neuzeit. Patchwork ist es laut wissenschaftlicher Definition erst dann, wenn zu den eigenen Kindern noch gemeinsame kommen. Laut der Befragung „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID) von 2009 leben schätzungsweise ein Drittel der Familien in Deutschland Patchwork.
In den 80ern in der Fernsehserie „Ich heirate eine Familie“ idealisiert, hat der bunt zusammengewürfelte Flickenteppich auch seine Tücken. Innerhalb der neuen Konstellation müssen sich die einzelnen Parteien in ihre neuen Rollen erst einfinden. Vielleicht war der Stiefvater vorher allein und hatte gar keine Kinder. Dann ist es umso schwerer, sich plötzlich in deren Lebensrealität hineinzudenken. Auch für das Verhältnis Stief-Vater zu Stief-Kind gilt: Beziehung kann man nicht verordnen, sie muss sich entwickeln.
Was verändert ein Patchwork-Vater im Leben der Familie? Die neue Situation dreht das System schlichtweg auf links. Kinder erleben den Prozess in Teilen passiv, da sie auf die Partnerwahl der Mutter nur wenig Einfluss haben. Wichtig ist, sie in den Prozess einzubeziehen und dass ihnen bewusst ist, dass ihre leiblichen Eltern, die jetzt nicht mehr zusammen leben, weiterhin einen verlässlichen Anker in ihrem Leben darstellen. Schwierig wird es, wenn unbearbeitete Konflikte oder verletzte Gefühle auf dem Rücken der Kinder ihren Austragungsort finden. Auch Loyalitätskonflikte schaden, im Sinne von „der Stiefpapa ist besser als Papa“. Das kann später Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben – „Wenn der doof ist, und das ist mein Papa, was bin ich dann?“.
Welche Rolle hat der leibliche Vater? Idealerweise ist er als verlässliches Pendant innerhalb des Formations-Prozesses präsent, um seine Kinder bei der Bewältigung zu unterstützen. Damit er aufgrund der neuen Person nicht seine eigene Rolle verliert oder der Stiefvater ihn aus dieser verdrängt ist es wichtig, ihn weiterhin in relevante Entscheidungen mit einzubeziehen. Dadurch, dass die leiblichen Eltern sich auch wohnlich trennen, also Multilokalität entsteht, ist es entscheidend, den Vater im Alltag weiterhin präsent zu halten mittels Fotos, Zeichnungen oder Erinnerungen. Denn, wer zur Familie zählt, erleben Kinder oftmals anders als ihre Eltern. Für Erwachsene zählen häufig die Personen, die mit im Haushalt wohnen, zur Familie. Kinder hingegen binden in ihren Familienbegriff auch den aus der alten Konstellation fehlenden Elternteil oder entfernt lebende Verwandte mit ein.
Auch sollte der Patchwork-Papa davon absehen, die Kinder je nach verwandtschaftlichem Grad zu benachteiligen, indem er die leiblichen Kinder bevorzugt. Das hat Einfluss auf die Beziehung zwischen den Stiefgeschwistern und kann vielleicht noch einmal wichtig werden, wenn die Patchwork-Eltern gemeinsam Nachwuchs planen. Hinsichtlich der Eifersucht unter den Geschwistern verhält es sich damit aber auch nicht anders als in traditionellen Familien, in denen ein Kind neu dazukommt.
Experten raten: Die Eltern, das schließt Stiefvater und leiblichen Vater gleichermaßen mit ein, sollten zu einer klaren Trennung hinsichtlich der Eltern-Ebene und der Eltern-Kind-Ebene kommen, damit sie gemeinsam im Sinne des Kindes agieren können. Gelingt das nicht aus eigener Kraft, können sie sich Unterstützung/Hilfe beispielsweise beim Kinderschutzbund oder Jugendamt holen. Nicht die Familienkonstellation ist entscheidend für die Entwicklung der Kinder, sondern ihre Beziehung zu den Eltern.
Das Aufwachsen im Patchwork macht auch widerstandsfähiger: So haben Kinder aus Patchwork-Familien einen sensibleren Blick für Diskriminierung und dafür, andere davor zu schützen. Und sie verfügen über flexiblere Rollenauffassungen von Mann und Frau als Kinder aus traditionellen Familien.
Lesen Sie weitere Artikel
zum Thema auch unter: choices.de/thema und engels-kultur.de/thema
Aktiv im Thema
www.rund-ums-baby.de/patchwork-familien | Ratgeber und reges Betroffenen-Forum zu Fragen aus dem Patchwork-Leben
daddylicious.de | Richtet sich an Väter und werdende Väter jeden Alters. Diskutiert Fragen aus Alltag, Kultur und Freizeit.
bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/stief--und-patchworkfamilien-in-deutschland/96024 | PDF-Ausgabe des vom Bundesfamilienministerium veröffentlichten „Monitor Familienforschung Ausgabe 31“ zu Stief- und Patchworkfamilien in Deutschland.
Benachteiligt? Sind die Männer verrückt geworden?
Sind Jungs die neuen Mädchen? Zukunft jetzt!
Schreiben Sie uns unter meinung@trailer-ruhr.de
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 „Wir haben keine Definition von positiver Männlichkeit“
„Wir haben keine Definition von positiver Männlichkeit“
Pädagogin Astrid von Friesen über Väter und Patchwork-Familien
 Schluss mit Daddy Cool
Schluss mit Daddy Cool
Nieder mit dem Väterlichkeitswahn – Thema 06/18 Vaterlos
Welt statt Wahl
Teil 1: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 2: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 1: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 2: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
Gleiches Recht für alle!
Teil 1: Leitartikel – Aufruhr von oben im Sozialstaat
Gerechtigkeit wäre machbar
Teil 2: Leitartikel – Die Kluft zwischen Arm und Reich ließe sich leicht verringern – wenn die Politik wollte
Die Mär vom Kostenhammer
Teil 3: Leitartikel – Das Rentensystem wackelt, weil sich ganze Gruppen der solidarischen Vorsorge entziehen
Streiken statt schießen
Teil 1: Leitartikel – Das im Kalten Krieg entwickelte Konzept der Sozialen Verteidigung ist aktueller denn je
Herren des Krieges
Teil 2: Leitartikel – Warum Frieden eine Nebensache ist
Unser höchstes Gut
Teil 3: Leitartikel – Von Kindheit an: besser friedensfähig als kriegstüchtig
Unbezahlbare Autonomie
Teil 1: Leitartikel – Die freie Theaterszene ist wirtschaftlich und ideologisch bedroht
Inspiration für alle
Teil 2: Leitartikel – Wer Kunst und Kultur beschneidet, raubt der Gesellschaft entscheidende Entwicklungschancen
Der Kulturkampfminister
Teil 3: Leitartikel – Wie Wolfram Weimer sein Amt versteht
An den wahren Problemen vorbei
Teil 1: Leitartikel – Journalismus vernachlässigt die Sorgen und Nöte von Millionen Menschen
Teuer errungen
Teil 2: Leitartikel – Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss bleiben – und besser werden
Journalismus im Teufelskreis
Teil 3: Leitartikel – Wie die Presse sich selbst auffrisst
Die Unfähigkeit der Mitte
Teil 1: Leitartikel – Der Streit ums AfD-Verbot und die Unaufrichtigkeit des politischen Zentrums
Hakenkreuze auf dem Schulklo
Teil 2: Leitartikel – Wo Politik versagt, haben Rechtsextremisten leichtes Spiel
Faschismus ist nicht normal
Teil 3: Leitartikel – Der Rechtsruck in Politik und Gesellschaft – und was dagegen zu tun ist
Der Ast, auf dem wir sitzen
Teil 1: Leitartikel – Naturschutz geht alle an – interessiert aber immer weniger
Keine Frage der Technik
Teil 2: Leitartikel – Eingriffe ins Klimasystem werden die Erderwärmung nicht aufhalten


