
„Das Europa-Gefühl existiert“
Zukunftsforscher Daniel Dettling über Europa als Heimat
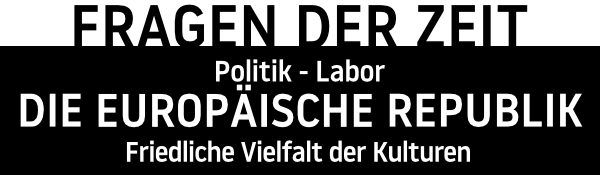
trailer: Herr Dettling, das Friedensprojekt Europa sollte eine gemeinsame Identität der Europäer stiften. Warum ist das bisher nur in Ansätzen gelungen?
Daniel Dettling: Die Zustimmungsraten zu Europa sind aktuell sehr gut. So hoch war die Akzeptanz der europäischen Integration in Deutschland schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sicher gab es eine hohe Unzufriedenheit in den letzten Jahren, die sich auf die Eurokrise bezog und auf den Umgang damit innerhalb der EU. Das war ein Thema, das bei vielen Unmut und Skepsis hervorgerufen hat. Gleiches gilt für die Flüchtlingskrise, bei der viele gesehen haben, dass Europa noch weit weg von einer Union ist. Der Binnenmarkt hat Europa bisher zusammen gehalten. Eine ökonomische ist aber noch keine politische Union. In vielen Fragen wie der Währung, dem Sozialbereich aber auch der Verteidigung der Außengrenzen gibt es noch zu wenig Europa. Die Bürger dachten, wir wären schon weiter, was die europäische Integration angeht. Der politische und rechtliche Integrationsprozess hinkt den normativen Erwartungen der Bürger hinterher. Wenn die Kluft zwischen Wahrnehmung und Erwartung so groß ist wie heute, kann Europa für die Bürger nicht Heimat sein. Europa muss schützen und nützen.
Ist der Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa auch als Abwehrbewegung gegen eine gemeinsame Identität zu verstehen?
Wenn man die Leute fragt, was sie mit Heimat verbinden, benennt die große Mehrheit ihr regionales, lokales Umfeld. Heimat ist für sie der Ort, wo sie aufgewachsen sind, wo sie Freunde haben. Die nächste Großstadt, das nächste Land oder auch Europa, sind zu weit weg, um geographisch Heimat darzustellen. Heimat definiert sich aber auch politisch, sozial und kulturell. Hier ist Europa für viele durchaus Heimat. Gerade auch in Abgrenzung zu anderen Räumen, wie den USA, Russland oder Asien. Heimat braucht immer auch Fremdheit. Das eine bedingt das andere. Das Thema Populismus lässt sich auch dadurch erklären, dass wir durch die Globalisierung in einer Zeit der Entgrenzung leben: Die Märkte und Grenzen sind offen. Die Geflüchteten der letzten Jahre haben den Europäern gezeigt, dass es auch eine Globalisierung für Menschen gibt. Die Erfahrung des plötzlichen Kontrollverlusts hat den neuen Populismus befördert. Europa muss wieder lernen, was es heißt, Grenzen zu haben, und wo diese Grenzen sind. Eine Welt ohne Grenzen ist eine Wüste.
Ist Europa zu abstrakt um ein Heimatgefühl zu vermitteln?
Das Europa-Gefühl existiert. Es gibt die Reisefreiheit und die Währungsunion. Die Leute wissen zu schätzen, dass sie an den Grenzen nicht kontrolliert werden und kein Geld umtauschen müssen. Es gibt kulturelle Events wie den EuropeanSong Contest oder die Europameisterschaft, all das stärkt ein Lebensgefühl, einen „european way of life“ in Abgrenzung zu anderen Kontinenten. Hohe Lebensqualität, wirtschaftliche Freiheit, demokratische Grundrechte, aber auch soziale Sicherheit, all das macht Europa aus – im Unterschied etwa zu den USA, wo es keinen Sozialstaat gibt. Wenn Sie so wollen, hat Donald Trump Europa sogar geholfen, sich noch stärker zu finden und eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Aber Heimat gibt es auch im Plural. Niemand hat nur eine Identität. Wir sind Deutsche, Sachsen und Berliner, aber darüber hinaus haben wir eben noch andere Identitäten, die wir frei wählen. Wolf Biermann wird der Satz zugesprochen „Deutschland ist mein Vaterland und Europa mein Mutterland“ – das drückt es meiner Meinung nach gut aus.
Was ist mit „Heimat“ überhaupt gemeint?
Heimat ist das, was uns vertraut ist, was wir gewohnt sind, also das eigene Umfeld, die Arbeitskollegen, die Familie. Aber sobald sich das Umfeld durch einen Wohnortwechsel oder Umzug ändert, spüren wir, dass die Definition von Heimat durchaus variabel sein kann. Das hat sich durch die Globalisierung und Digitalisierung noch gesteigert. Plötzlich ist die Welt ein Dorf und was in Afrika oder Syrien passiert, hat direkte Konsequenzen für Europa. Das war vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Die Welt rückt näher an Deutschland und Europa heran und das fordert unsere klassischen Definitionen von Heimat und Vaterland heraus. Das führt am Ende zu einer Konfrontation zwischen den einen, die sich zurückziehen und für die Heimat etwas Nationales und Homogenes ist, und den anderen, die überzeugt sind, dass wir davon profitieren.
Sie sprechen auch von Glokalisierung. Können Sie das erläutern?
Glokalisierung ist ein Synthesebegriff. Megatrends wie die Globalisierung oder die Digitalisierung führen immer auch zu Gegentrends. Der Populismus ist ein Gegentrend zur Globalisierung, von der die Populisten sagen, dass sie nur den Eliten nützt. Die Glokalisierung stellt nun eine Verbindung zwischen zwei gegenläufigen Trends her, nämlich der Globalisierung und der Lokalisierung, die miteinander verschmelzen. Es geht um die Aufwertung von Kommunen und ländlichen Gemeinden. Städte und Regionen, Heimat und Zusammenhalt werden wieder wichtiger. Die Glokalisierung ist die nächste Stufe der Globalisierung. Die Welt wird zum Dorf, aber umgekehrt wird das Dorf auch zur Welt. Wo wir wohnen, spielt letztlich kaum noch eine Rolle. Wir können in der Stadt provinziell sein, aber auch auf dem Land ein urbanes Leben führen. Beides geht ineinander über und verschmilzt.
Welche Rolle spielt Europa bei diesem Prozess?
Europa ist ein politischer Akteur, der solche Trends auch gestalten kann und nicht nur reagieren muss. Europa muss sich stärker auf die Zukunft einstellen, indem es sich aktiv mit den Veränderungen auseinander setzt und Lösungen entwickelt, wie beispielsweise ein gemeinsames Währungssystem und ein vergleichbares Wirtschaftssystem. Gemeinsam ist die EU stärker, von daher ist Europa ein wichtiges System der Antwort, der Reaktion, aber auch der Innovation auf unvorhergesehene Ereignisse. Europa kann sich behaupten und kreative Antworten finden auf die genannten Megatrends.
Könnten die Nationen innerhalb der Union an Bedeutung verlieren und die Regionen gewinnen?
Das 21. Jahrhundert wird die Epoche der Regionen und Städte. Die Regionen sind die Einheit, in der wir uns im Alltag bewegen, in der wir unsere Bedürfnisse befriedigen, wo Arbeit, Familie, Mobilität und Vereinsleben stattfinden. Globalisierung und Internationalisierung führen zu einer Aufwertung der Regionen. Der Nationalstaat wird als Zwischeninstanz zwischen Welt und Region nicht mehr die Rolle spielen, die er früher gespielt hat, weil die großen Fragen zunehmend im europäischen und internationalen Rahmen beantwortet und geregelt werden, während die kleinen Fragen, etwa Fragen der Bildung, der Vereine, des Sports und der Familien, in den Regionen gelöst werden. Die Nationalstaaten werden zum Überbleibsel der alten Zeit und sind wichtig, weil sie den meisten noch vertraut sind. Die Nationalstaaten, in denen unsere Volksvertreter organisiert sind, werden zu Managern der Regionen und der EU. Im Moment sind vor allem jene Regionen für Populismus anfällig, die weniger industrialisiert sind und von Globalisierung, Fortschritt und Wohlstand abgekoppelt sind. Deshalb wird die Aufwertung der Regionen auch mit mehr Umverteilung zwischen den Regionen verbunden sein. Das Thema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“, das wir aktuell im Zusammenhang mit der Frage nach dem künftigen Verhältnis von Stadt und Land diskutieren, wird auch für Europa eine der zentralen Zukunftsfragen.
Die Europäische Republik - Lesen Sie weitere Artikel
zum Thema auch unter: choices.de/thema und engels-kultur.de/thema
Aktiv im Thema
heimat-europa.eu | Das Projekt richtet sich an Jugendliche und bietet Seminare für DemokratiebotschafterInnen an.
nrw-stiftung.de | Die Stiftung unterstützt gemeinschaftliches Engagement für Natur, Denkmäler und Kultur in NRW.
pulseofeurope.eu | Die Bewegung macht seit zwei Jahren mit zahlreichen Regionalgruppen mobil gegen EU-Bashing.
Fragen der Zeit: Wie wollen wir leben?
Schreiben Sie uns unter meinung@trailer-ruhr.de
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Müh(l)en Europas
Müh(l)en Europas
Intro - Europa
 Sind wir Europäer?
Sind wir Europäer?
Wenn aus Gegnern Verbündete werden
 Die letzten Europäer?
Die letzten Europäer?
Wer klein und schwach ist, muss sich starke Freunde suchen – Europa-Vorbild: Luxemburg
 Gegen den Trend des Inaktiv-seins
Gegen den Trend des Inaktiv-seins
Die Jungen Europäische Föderalisten träumen von den Vereinigten Staaten Europas
 Wohlige Zerstückelung
Wohlige Zerstückelung
Zurück zur Romantik: Von leidenschaftlichen EU-Mehlkörnern
 Die letzten Europäer? – Beispiel Luxemburg
Die letzten Europäer? – Beispiel Luxemburg
Wer klein und schwach ist, muss sich starke Freunde suchen
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 1: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 2: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 1: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 2: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 1: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 2: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Kultur muss raus ins Getümmel“
Teil 3: Interview – Philosoph Julian Nida-Rümelin über Cancel Culture und Demokratie
„Das Gefühl, Berichterstattung habe mit dem Alltag wenig zu tun“
Teil 1: Interview – Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing über Haltung und Objektivität im Journalismus
„Die Sender sind immer politisch beeinflusst“
Teil 2: Interview – Medienforscher Christoph Classen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
„Nicht das Verteilen von Papier, sondern Journalismus fördern“
Teil 3: Interview – Der Geschäftsführer des DJV-NRW über die wirtschaftliche Krise des Journalismus
„Die Chancen eines Verbotsverfahren sind relativ gut“
Teil 1: Interview – Rechtsextremismus-Forscher Rolf Frankenberger über ein mögliches Verbot der AfD


