
„Das Denken der Verbrecher nachvollziehen“
Correctiv-Journalist Frederic Richter über den europäischen Cum-Ex-Steuerbetrug
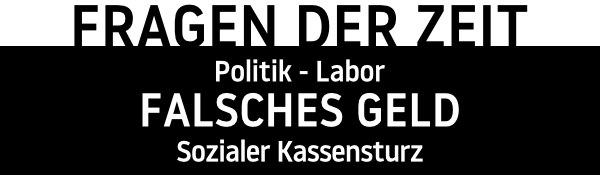
trailer: Unter dem Titel „CumEx-Files“ veröffentlichte Correctiv am 18. Oktober 2018 in Kooperation mit weiteren Medien aus elf Ländern über mehrere Jahre erarbeitete Rechercheergebnisse zum europäischen Cum-Ex-Steuerbetrug. Sie waren an dieser Mammutrecherche beteiligt, die Steuerhinterziehung im großen Stil öffentlich gemacht hat. Wie kam es dazu?
Frederic Richter: Wir hatten das Thema in Deutschland schon länger auf dem Schirm. Auch die Behörden waren bereits tätig um den Steuerbetrug durch Cum-Ex zu verhindern. Das führte allerdings dazu, dass dessen Urheber ins Ausland auswichen – und dort ihren kriminellen Machenschaften nachgingen. Bis zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung war das in den anderen betroffenen europäischen Ländern jedoch noch kein Thema, gerade in Frankreich oder Spanien. Dort haben wir das Thema mit unseren Recherchen überhaupt erstmal bekannt gemacht.
Als Cum Ex wird eine Art Steuerhinterziehung bezeichnet, bei der fünf europäische Länder Beträge in Milliardenhöhe verloren haben. „Wie Banker, Anwälte und Superreiche Europa ausrauben“, so lautete der Untertitel zur Recherche. Wie sind die Verbrecher vorgegangen?
Die Recherchen belegen konkret, dass durch rein steuergetriebene Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, also Cum-Ex, Cum-Cum und vergleichbare Handelsstrategien, neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Dänemark, Belgien, Österreich, Finnland, Norwegen und die Schweiz geschädigt wurden. Der Schaden durch „steuergetriebene Geschäfte“ von mindestens 55,2 Milliarden Euro ergibt sich aus Auskünften von Steuerbehörden sowie Analysen von Marktdaten. Bei den, in der Finanzbranche auch als „Tax Deals“ bekannten, Geschäften werden kurzfristig riesige, oft milliardenschwere Aktienpakete hin- und hergeschoben, um sich Steuern zu Unrecht erstatten zu lassen. Bei Cum‐Ex-Geschäften und seinen Varianten wird eine einmal abgeführte Steuer sogar mehrfach erstattet.
Eine derart komplexe Recherche der breiten Masse zu veranschaulichen, ist sicher nicht einfach. Nicht ohne Grund hat Cum-Ex so lange funktioniert. Wie schwierig war es, dieses Thema herunterzubrechen?
Es geht um sehr komplexe Aktiengeschäfte, mit denen sich die wenigsten Menschen auskennen. Da macht eigentlich nur Sinn, mit Visualisierungen zu arbeiten und das Geschehene bildlich darzustellen. Aber das ist immer eine der zentralen Herausforderungen – zum einen selber zu verstehen was passiert ist, dann das Denken der Urheber, also der Verbrecher nachzuvollziehen, was hier aufgrund der Komplexität des Themas besonders schwierig ist. Ich denke aber, dass wir das ganz gut hinbekommen haben.
Apple, Google, Amazon oder Starbucks, diese Namen fallen immer wieder, wenn es um Steuervermeidung geht. Gigantische Einnahmen entgehen den Volkswirtschaften, wenn ein Global Player seinen „Briefkasten“ dort aufstellt, wo nur 0,005 Prozent Unternehmenssteuern fällig werden. Verboten ist das nicht, aber ungerecht – ebenso ein Thema für Correctiv?
Dass sich weltweit agierende Konzerne aussuchen können, wo sie Steuern zahlen und natürlich den niedrigsten Satz nehmen, ist eines der Probleme unserer Zeit, weil sie die Politik und damit die Demokratien in den im Steuerrecht sehr nationalstaatlich gefassten Ländern, stark unterminieren. Deswegen ist es ein extrem wichtiges Thema für den Journalismus. Uns ist dieses Thema in unserer Serie „Wem gehört Hamburg“ und „Wem gehört Berlin“ begegnet. Wir haben herausgefunden, dass sich viele Wohnungen in beiden Städten im Eigentum von Firmen aus Irland oder Luxemburg befinden. Diese Steueroasen fliegen gerne unter dem Radar, wenn man an klassische Steueroasen denkt: die Karibik, die britischen Kanalinseln und der Bundesstaat Delaware in den USA. Der Sitz vieler Firmen aus Berlin befindet sich oftmals ebenso dort. Das Problem ist, dass die Konzerne hier in Deutschland ihren Gewinn machen, hiesige Dienstleistungen und Rechtssicherheit in Anspruch nehmen, die Städte Berlin oder Hamburg davon aber nichts haben, weil die Steuern in Luxemburg oder den Niederlanden gezahlt werden – wenn überhaupt.
Was tragen etwa Correctiv-Recherchen dazu bei, dass sich etwas ändert?
Einzelne Veröffentlichungen dazu ändern sicher nichts, aber die Masse. Frei nach dem Motto: steter Tropfen höhlt den Stein. Wichtig ist: Es kommt immer auch auf gesellschaftliche Flankierungen an. Der Journalismus muss mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Denn die Berichterstattung ist lediglich ein Kanal, auf Missstände aufmerksam zu machen. Nur gemeinsam können diese beseitigt werden.
Falsches Geld - Lesen Sie weitere Artikel
zum Thema auch unter: choices.de/thema und engels-kultur.de/thema
Aktiv im Thema
panamapapers.sueddeutsche.de | Die Recherchen der Süddeutschen Zeitung zum Panama Papers-Skandal.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_DE.html | Entschließung des europäischen Parlaments zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung.
cumex-files.com | Zusammenschluss von 19 Medien aus zwölf Ländern, um die Cum-Ex-Geschäfte zu untersuchen.
Fragen der Zeit: Wie wollen wir leben?
Schreiben Sie uns unter meinung@trailer-ruhr.de
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Voll verdient
Voll verdient
Intro - Falsches Geld
 Auf dem reichen Auge blind
Auf dem reichen Auge blind
55 Milliarden Euro aus Staatskassen verloren
 Komplexe Schwierigkeiten des Steuervollzugs
Komplexe Schwierigkeiten des Steuervollzugs
Das Kompetenzzentrum Steuerrecht der RUB vermittelt Grundlagen
 von unbenannt.jpg) Aus der Krötenperspektive
Aus der Krötenperspektive
Die Unsicherheit des Geldes
 von adobestock-86156003-kopie.jpg) Transparenz von Hinterzimmergesprächen
Transparenz von Hinterzimmergesprächen
Das irische Lobbyregister – Europa-Vorbild: Irland
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 1: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 2: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 1: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 2: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 1: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 2: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 1: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 2: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 1: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 2: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Kultur muss raus ins Getümmel“
Teil 3: Interview – Philosoph Julian Nida-Rümelin über Cancel Culture und Demokratie
„Das Gefühl, Berichterstattung habe mit dem Alltag wenig zu tun“
Teil 1: Interview – Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing über Haltung und Objektivität im Journalismus
„Die Sender sind immer politisch beeinflusst“
Teil 2: Interview – Medienforscher Christoph Classen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
„Nicht das Verteilen von Papier, sondern Journalismus fördern“
Teil 3: Interview – Der Geschäftsführer des DJV-NRW über die wirtschaftliche Krise des Journalismus
„Die Chancen eines Verbotsverfahren sind relativ gut“
Teil 1: Interview – Rechtsextremismus-Forscher Rolf Frankenberger über ein mögliches Verbot der AfD
„Man hat die demokratischen Jugendlichen nicht beachtet“
Teil 2: Interview – Rechtsextremismus-Experte Michael Nattke über die Radikalisierung von Jugendlichen


